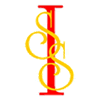Kann man eine Krise – beispielsweise die Klimakrise – bewältigen, ohne zu verzichten, lautet derzeit eine aktuelle politische Streitfrage (Kurz: Klimakrise ohne Verzicht zu bewältigen – news.ORF.at).
Das Wort „verzichten“ ist eines von denjenigen Begriffen, die üblicherweise sofort heftige Emotionen auslösen – bei den Menschen, die in ihrer Biographie Episoden besitzen, in denen ihnen etwas weggenommen wurde und die mit verstärktem Festhalten (bzw. zumindest mit dem Impuls dazu) reagiert haben. Es gibt aber auch andere, die in solchen Situationen loslassen und dann entweder nachfolgend protestieren (da gehört auch das Sich-beklagen dazu, und das kann chronisch werden – ein Zeichen, dass ein Trauma, wie klein es auch sein mag, noch nicht geheilt ist) oder „austrauern“ (eine Form der Heilung).
Dabei verzichten wir unentwegt – wenn man verzichten als den einen Teil einer Entscheidung ansieht, in der man nur eine Alternative verwirklichen kann. Ich verwende im Unterricht oder Training zur Verdeutlichung immer das Beispiel des Beine-übereinander-Schlagens: Es geht nur rechts über links oder links über rechts. (Auf aristotelische Diskussionen über das „tertium non datur“ lasse ich als leidenschaftliche Konstruktivistin mich dabei nicht ein, weil es mir hier nicht um mentale Logik geht, sondern um physische Biologie.)
Die Frage des Verzichtens ist eine ethische und lautet zuallererst: Ist der bewusste Akt des Verzichtens überhaupt im individuellen oder kollektiven Verhaltensrepertoire enthalten, und wenn ja, in welchem Kontext? Weiß jeder Mensch, wie man das macht? Hatten er oder sie ein Vorbild – und eine Erlaubnis? Oder wurde stets vermittelt – ich zitiere ein seinerzeitiges Spontangedicht eines Kollegen-kritischen Wiener Kommunalpolitikers „Kriegst du was für’s BFI, sei nicht blöd, behalt’s für di(ch)!“ Macht man nur nach, was propagiert wird – nämlich Egozentrik? (Fairness etwa besteht im Verzicht auf eigenen Vorteil, wenn er jemand anderem zum Nachteil geraten würde. Wir haben kein deutsches Wort dafür – weshalb?)
Ich lese derzeit das Buch „Jugend unter Hitler. Menschenschicksale im Dritten Reich – Zeitzeugen berichten“ von Maria Grabner und Marina Watteck (Kral Verlag 2021) – es sind übrigens fünf Männer und vierzehn Frauen (von wegen gendern), davon fünfzehn der Geburtsjahrgänge 1920 bis 1929, drei aus den 1930er Jahren und eine aus 1940 – in denen man deren Ängste wie Bewältigungsstrategien, Leid und Dankbarkeiten im O-Ton erfährt. Verzicht fehlt in den Berichten über die Not-wendigen Einschränkungen.
Ich – geboren 1944 – habe noch den Permanent-Sager der meisten Mütter meiner Freundinnen im Ohr, wenn sie mit „Wir haben das auch nicht gehabt!“ (bzw. „gedurft“) den „neumodischen“ Begehrlichkeiten ihrer Töchter Absagen erteilten. In den 1950er Jahren war es der US-Lifestyle: Die Töchter wollten Lippenstift, Mascara und Nylons – die Mütter hingegen amerikanische Küchen samt Elektrogeräten. Wenn man die folgenden Jahrzehnte danach betrachtet, für welche neuen Angebote geworben wurde und mit der aktuellen Berichterstattung vergleicht, fällt auf, wie stark die Themen Nachtgastronomie und ausländische Urlaubsdestinationen dominieren … und dass die Menschen sich genau danach sehnen. Wirklich?
Haben sich in der Pandemie nicht eher Bedürfnisse verschoben? Hat es nicht eher überwiegend eine Verschiebung zu einerseits mehr Selbermachen und damit Konzentration auf daheim und andererseits Erkenntnisse, was alles man gar nicht „braucht“ (nämlich wiederholt gebraucht), gegeben? Und ist das, was fehlt, eher Austausch (und auch Tausch!) mit anderen und damit das Lebendigkeitsgefühl, das sich aus dem „in Beziehung sein“ ergibt (wenn es wirklich eine Beziehung ist und nicht bloß ein „nur zugleich am gleichen Ort“)?