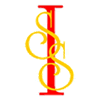Ich habe es aufgegeben zu zählen, wie oft das Wort Streit bzw. streiten in den letzten Wochen in den Zeitungen, die ich täglich lese, vorgekommen ist. Aber sehr sehr oft. Vor allem in Bezug auf die Regierungspartner, die politischen Parteien, hingegen wesentlich weniger in Hinblick auf Familienkonflikte oder Männerkämpfe.
Ich versuche das Wort Streit so gut es geht zu vermeiden. Es schafft nämlich allein durch das Aussprechen oder Lesen bereits eine Atmosphäre von Intoleranz und erhöht damit die Gewaltbereitschaft. So zeigen psychologische Studien immer wieder auf, dass Probanden, wenn sie vorher Gewaltszenen gesehen haben, Konfliktlösungsaufgaben weniger sachlich bzw. in einem weniger vernünftigen Gemütszustand lösen, als wenn dies nicht der Fall ist. Wir brauchen aber auch nur bei uns selbst beobachten, wie sich unsere Atmung und Muskelspannung verändert, wenn wir – ohne vorgewarnt zu sein wie hier – mit dem Wort „Streit“ konfrontiert sind! Dagegen hat das Wort „Streitigkeiten“ diese Wirkung nicht, sondern eine mildere.
„Streiten“ tun kleine Kinder in der Sandkiste, die die Umsetzung ihrer emotionalen Impulse in körperliche Aktionen noch nicht kontrollieren können. Sie schreien und tatschen und trommeln dann irgendwohin, bis infolge besserer Muskelkontrolle (so ab dem dritten Lebensjahr) gezieltes Schlagen daraus wird. Leider tun das oft auch ihre Eltern und liefern so ein Alltagsvorbild lange bevor die gleichartigen medialen Modelle diese „Verhaltensmöglichkeit“ verfestigen.
Regierungsmitglieder oder andere Politiker tun das nicht – zumindest nicht bei uns in Österreich. Deswegen finde ich es falsch, wenn medial davon berichtet wird, dass sie „streiten“ – die Suggestion könnte sich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung auswachsen …
Politiker „sind uneins“, „haben Differenzen“, „befinden sich in Konflikt“ oder „Opposition“, sie „ringen um Lösungen“ oder sind ungeduldig, ärgerlich, enttäuscht … aber streiten wie die Kleinen tun sie nicht.
Als Witwe eines Journalisten, der auch jenseits seines Berufes zu Übertreibungen neigte, habe ich zwar für diese „Berufsdeformation“ Verständnis – sie gehört aber sprachpolizeilicher Kontrolle unterworfen. Ihm konnte ich immer wieder sagen „Reg‘ mich nicht auf!“ und „Du bist für mich so schon aufregend genug …“ – Journalisten hingegen versuche ich darauf hinzuweisen, wenn ich ab und zu Gelegenheit zum Unterricht erhalte, wie konkret mit Sprache „Stimmung“ gemacht wird und wo man dies tunlichst vermeiden sollte (z. B. bei Berichten über sexuelle Gewalt).
Wir wissen wohl alle, dass früher (in den angeblich primitiven Gesellschaften, aber auch bei uns) traditionell und bewusst mit Hassgesängen, Getrommel und Marschmusik oder Gestampfe Kampfstimmung erzeugt wurde. Kurz aufeinander folgende Wortwiederholungen haben sie gleiche, allerdings unbewusste Wirkung (außer mannfrau ist linguistisch dafür sensibilisiert).
Dank dem Betroffenenouting von vier mutigen Journalistinnen sind heuer Hasspostings zum öffentlichen Thema geworden. Aber jede Hassäußerung hat eine Geschichte und die wurzelt in den geistigen Bildern, d. h. Erfahrungen, die mit dem jeweiligen Wort verbunden sind. Streiterfahrungen besitzen wir alle aus frühester Kindheit, deswegen sitzen sie ja so fest und bleiben unbewusst, wenn sie nicht hervorgeholt und zwecks Entwicklung einer „Streitkultur“ – besser wäre das Wort „Konfliktkultur“, das ich hiermit propagieren möchte – bearbeitet werden.
Kultur liegt nicht in unseren Genen – wir müssen sie erarbeiten.