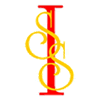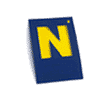Täglich werden die Zahlen der an Covid-19 Erkrankten, Gestorbenen und Genesenen veröffentlicht – und gleichzeitig häufen sich die Stimmen derer, sie sagen, die Verstorbenen wären ohnedies verschieden, auch ohne die Gefährdung durch die aktuelle Pandemie. Darin vermute ich deren spontane Abwehr der Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben.
Aus der „Distanz der Unbetroffenen“ (© Cornelia Kazis) ist es leicht, anderen das Lebensrecht abzusprechen. Noch immer ist der „Schoß fruchtbar noch, aus dem das kroch“ (Bert Brecht, „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“, Epilog) – und noch immer zitieren Unbelehrbare die Nazi-Phrase vom „lebensunwerten Leben“. Sie ignorieren die Tatsache, dass der Wert eines Menschen nicht in seiner wirtschaftlichen „Nützlichkeit“ besteht, sondern als Teil eines bioenergetischen Austausches von Achtsamkeit, Zuwendung und Fürsorge – denn auch die muss man lernen und ausüben, sonst verkümmert dieses Potenzial. (Lernen erkläre ich als „Bilden von Neurosignaturen“ – also Wahrnehmungs- wie auch Handlungsnervenzellen.) Wenn wir unsere Liebensfähigkeit erweitern wollen, brauchen wir Menschen oder Situationen, bei denen uns diese Fühlkompetenz nicht „einfach zufliegt“, sondern erarbeitet werden muss. Das ist immer dann der Fall, wenn etwas „lästig“ ist – unerwünscht, bedrohlich, unkontrollierbar, ängstigend.
Wenn man selbst schon einmal dem „Totengräber von der Schaufel gesprungen“ ist – so wie ich im Februar 2010, nachzulesen in meinem Buch „Als Pfarrerlehrling in Mistelbach“ (Restexemplare nach Konkurs der Auslieferung Dr. Hain nur mehr bei mir erhältlich) – haben viele ein gelasseneres Verhältnis zum eigenen Tod … aber keines, wenn es um diejenigen geht, die sie lieben. Oder zu denen man ein besonderes Verhältnis hat, weil sie Anstoß oder Vorbild für die eigene Entwicklung waren.
Wenn also jemand von den Jungen – die auch nicht vor dem Tod gefeit sind – „urcool“ sagt, die Alten sollten für die Jungen platz machen, dann frage ich immer, an wen sie dabei denken: An Hugo Portisch? Oder Erika Pluhar? Oder Otto Schenk? (Mich selbst lass ich aus – ich bin erst in ein paar Jahren 80.)
Aber ans Sterben zu denken, ist schon sinnvoll: Nicht um es weit von sich wegzuweisen, sondern um daran zu denken, dass alles seinen Tod hat, aber zu seiner Zeit … auch die Umwelt, und daher auch Vorhaben, Unternehmungen, Firmen, Parteien, Staaten, und ebenso Beziehungen – wenn wir sie nicht pflegen und behüten. Die Schwierigkeit besteht darin, den Kairos – den rechten Zeitpunkt – zu erkennen, und das gelingt am besten „mit weit offenem Herzen“ und der Bereitschaft, allfällige Verluste zu betrauern anstatt sich vor ihnen zu ängstigen. (Angst ist dann das Thema von Brief Nr. 33 – ich bin vorlesungs-bedingt mit drei „Briefen“ im Rückstand).