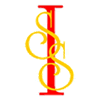Als ich noch Bezirksrätin in Wien Favoriten war (1973–1987) erzählte mir eine Genossin, vermutlich ein Jahrgang aus den frühen 1930er Jahren, die zur Zeit unseres Gesprächs in der Arbeiterkammer arbeitete, dass sie Ende der 1940er Jahre, Arbeit suchend am Arbeitsamt – heute AMS – vorsprach und zu hören bekam, sie sei doch hübsch, sie werde doch einen Herren finden, der sie erhalte (und dabei war nicht an Heirat gedacht).
Wir waren uns damals einig, dass diese gedankliche Entgleisung wohl der Erziehung der wohlangestellten Beraterin zuzurechnen sei, die halt noch im Zeitgeist des 19. Jahrhunderts dachte – so wie meine sehr geliebte mütterliche Großmutter, bei der ich während meines Studiums gelegentlich wohnte, und die jedes Mal, wenn mich ein Kommilitone abholte, nachher fragte „Na wär‘ der nichts?“ (nämlich zum Heiraten), aber daran dachte ich gar nicht, ich wollte mich beruflich beweisen und auch Karriere machen (war als einziges Mädchen „mit Dispens“ in einem altsprachlichen Gymnasium für Knaben, dort wurden wir ja daraufhin „programmiert“ – und dass das nicht für Frauen galt, habe ich erst in der damaligen SPÖ mitbekommen – heute ist es aber auch nicht viel anders).
In der Partei hörte ich „Ein Mann ist kein Ersatz für einen Beruf“, und als ich meinen Beruf als Juristin mit dem – grob gesprochen – eines sozialen Beistands vertauschte (denn bei Gericht erlebte ich genau das Gegenteil), erfuhr ich unzählige Male das Leid der Frauen, die von verantwortungslosen, gewalttätigen Ehemännern abhängig waren, und seitdem engagiere ich mich dafür, dass das aufhört.
Meine eigene Mutter – gelernte Volksschullehrerin und Konzertpianistin – durfte aus Druck ihres Ehemannes ihren Beruf nie ausüben, außer im Krieg, da musste sie, noch kinderlos kriegsdienstverpflichtet, auf der Wetterwarte Karten zeichnen; das wäre ihre schönste Zeit gewesen, erzählte sie mir erst nach dem Tod meines Vaters, er musste aufgrund seiner Sprachkenntnisse (zu Lebensende beherrschte er 27!) in Berlin übersetzen und decodieren, und sie war Freifrau in Wien mit eigenem Verdienst und niemand redete ihr drein. Ich selbst habe ihr das schon früh abgeschaut.
Umso entsetzter war ich, als ich vor zwei Tagen erfuhr, dass einer Arbeit suchenden Kollegin (mit einer Biographie des Überlebenskampfes gegen Machos) andauernd geraten wurde (auch von Frauen!), sie brauche eben unbedingt einen Mann zur Verbesserung ihrer Lebenslage – und die anwesenden Männer boten sich immer gleich dafür an, aber nur zum Kraft spenden (solange sich frau brav unterordnet).
Wieso sie immer an solche Typen käme, die am Anfang so charmant seien und sich dann als verantwortungslose Trinker entpuppten, fragte sie mich. Weil die schon von weitem riechen würden, dass sie eine „Mutterfigur“ (ohne Inzestschranke!) wäre, die Ordnung in deren Chaos bringen würde – eben eine Kämpferin, bei der sie sich ankuscheln wollten – aber wenn sie um ihr existenzielles Überleben kämpfe, gegen Vermieter oder Ämter etc., würden die angeblichen Partner dann zu den anderen Männern halten, „Krähensolidarität“ (eine hackt der anderen kein Auge aus, wie der Volksmund weiß) habe ich das in einem meiner Bücher genannt. Stimmt, sagte die Kollegin – ihre Lebenserfahrung.
Diese alten Rollenbilder geistern noch immer herum – in den Köpfen. Bei Männern heißt es dann im umgekehrten Fall, „der braucht eine Frau“ sprich Mutterfigur, wenn er sein Leben (seine Wohnung, seine Finanzen) nicht in Ordnung bringt.