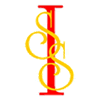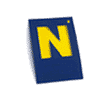„Sollen Menschen, die sich in Umweltverfahren engagieren, zwangsweise vor den Behörden ,geoutet‘ werden?“, fragt Andreas Koller in den Salzburger Nachrichten vom 5. Oktober 2018 (Seite 2), nachdem bekannt wurde, dass künftig Umweltorganisationen nur mehr Parteien- und Beteiligtenstellung in Umweltsverträglichkeitsprüfungsverfahren besitzen sollen, wenn sie über 100 Mitglieder haben, und außerdem deren Namen und Adressen offengelegt werden sollen. Dass dies den neuen Datenschutzrichtlinien widerspricht, werden wohl alle erkannt haben, die personenbezogene Daten „verwalten“ (d. h. in ein geordnetes System gebracht haben). Dagegen protestiert haben bereits Berufenere als ich.
Was mich daran stört – und worin ich eine Form von struktureller Gewalt erblicke – ist die Vorschreibung einer Quantität von Mitgliedern. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass einer Organisation, die aus einer Minderzahl von Experten, sagen wir etwa fünf Biologen, gebildet wurde, die Mitsprache schlicht verweigert wird, hingegen eine Hundertschaft von Bergsteigern die Kompetenz zugesprochen wird (wobei in dieser vermutlich auch nur fünf Experten das fachlich fundierte Sagen hätten – nur „Meinungen“ haben viele, wie dieses Wort ja schon vom Ursprung her aufdeckt).
Begutachtende Vereine oder Institutionen kann man nicht mit Quotierungen wie Nationalrats-, Landtags- oder Gemeindewahlen „messen“. Will man das, sind dafür die Instrumentarien der direkten Demokratie vorgesehen und geeignet (und außerdem ein Signal respektvoller Bürgernähe). In den Medien wird vermutet, es ginge um Entmachtung von NGOs (Non-Govermental Organisations, also Nicht-Regierungs-Organisationen). Aber wozu diese Vorsicht (oder Angst)? Weil dann Widerstand kommen könnte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies die Regierung von ihren Plänen abhalten würde. Außerdem ist es ein leichtes, viele regierungstreue NGOs zu gründen. Allerdings muss man dann damit rechnen, dass mit zunehmender Akteneinsicht Umdenken wachsen kann – aber das fördert dann Diskurse und Diskussionen, und die kann man zeitlich beschränken – was ja ohnedies geschieht, vor allem, wenn man jemand faire Chancen nehmen will. Als ich mich anlässlich meiner Eintragung in die Gerichts-Sachverständigen-Liste einer „Anhörung“, d. h. Prüfung in der Ärztekammer (!) unterziehen musste, bekam ich diese Aufforderung einen Tag vor dem Termin zugestellt; offensichtlich wussten die Prüfer nicht, dass ich vom Erstberuf Rechtswissenschaftlerin bin – denn sie fragten mich primär Juristisches – vermutlich in der Hoffnung, damit eine Psychologin aufs Glatteis führen zu können – was ich aber natürlich alles wusste. Die einzige Frage, die ich nicht beantworten konnte, war die nach den Tarifen für die Verrechnung der Gutachtertätigkeit … was aufzeigt, was bei wem im Denken Vorrang hat.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie VertreterInnen der SP-„Familienorganisation“ der „Kinderfreunde“ geklagt haben, sie wären nur eine Organisation, die „anderen“ aber hätte mehrere (meist mit dem Wort „katholisch“ im Titel). Das zeigt wiederum auch, was wem wie wichtig ist. Und dann kann ich mich erinnern, dass Bürgermeister Leopold Gratz anlässlich des Entstehens (und Widerstands) der ersten „Bürgerinitiativen“ nicht müde wurde, öffentlich zu betonen, die SPÖ sei die allererste Bürgerinitiative gewesen (und deswegen widerständiger, mutiger und vertrauenswürdiger).
Ein Mythos bedeutet in den Systemtherapien einen Glaubenssatz, der nicht in Frage gestellt werden darf. Dazu zählt beispielsweise der Mythos, dass Ältere klüger als Jüngere seien (dabei sind sie nur „erfahrener“, was aber nicht klüger bedeutet – Klugheit lässt sich ja nicht an biographischen Jahreszahlen messen!), oder Männer moralischer als Frauen (ein Fehlschluss Sigmund Freuds, den er aus den Träumen und Assoziationen seiner Patientinnen zog), oder eben, wer oder was von vielen unterstützt wird, beweise Sachverstand und Verantwortungsbewusstsein. Wenn solch eine „Spielregel“ eingeführt wird, kann sie mit Berufung auf den Präzedenzfall immer wieder vorgeschrieben werden. Ich meine aber, dass immer Qualität vor Quantität gehen sollte. (Und Qualität kann dann kritisiert werden – und dass das passiert, zeigt sich beispielsweise an Postenbesetzungsvorhaben.)