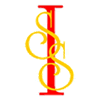Üblicherweise werden Kinder nur dann von ihren Eltern entfernt, wenn diese sie schwer misshandeln oder grob vernachlässigen – und das muss konkret nachgewiesen sein beispielsweise durch sichtbare und einschlägig zuordenbare Verletzungen oder durch Augenzeugen.
Nun hat ein italienisches Gericht ein derzeit siebenjähriges Mädchen endgültig den Pflegeeltern als Adoptivkind zugesprochen, bei denen es schon längere Zeit gelebt hat, weil dessen leibliche Eltern – die Mutter derzeit 63 und der Vater 75 – so das Gericht, „zu alt und zu narzisstisch“ seien, das Kind daher bald mit Pflegeaufgaben belastet oder überhaupt gleich zur Waise würde.
Dazu ist konkret festzuhalten: Diese „Prognosen“ sind Phantasien. Ob sie jemals real werden, weiß niemand. Würde der Vater 90 (Mutter 78), wäre das Kind 22 … und das ist im heutigen Stand der Medizin durchaus möglich. Aber darum geht es nicht. Es geht um einen Streit zwischen leiblichen Eltern und Pflegeeltern, wie den Tageszeitungen vom 15. März 2017 zu entnehmen war – und um, so vermute ich, die Argumentation des Rechtsanwalts der Pflegeeltern, der sich das Gericht angeschlossen hat. Das Gericht – oder vorher schon die Jugendwohlfahrtsbehörde – hätte ja auch die Position vertreten können, dass viele Kinder bei ihren Großeltern aufwachsen, etwa wenn die Eltern verunfallen, und man erst dann tätig werden muss, sofern das Kind noch minderjährig ist.
Doch es wurde der Tatsache, dass das Kind durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde, gleich die psychiatrische Diagnose Narzissmus zu gekoppelt. Nun wissen wir zwar nicht, worauf sich diese „Etikettierung“ stützt – etwa, dass das Kind wie eine Puppe herausgeputzt und vorgeführt wurde – was ja auch junge Eltern und Großeltern häufig tun. Den gesunden Narzissmus vom krankhaften zu unterscheiden, steht nur Fachleuten zu – und sogar die sind häufig nicht frei von biographisch motivierten Vorurteilen. (Deswegen werden Psychotherapeuten in ihrer Aus- und Weiterbildung viele Stunden Selbsterfahrung vorgeschrieben, damit sie ihre persönlichen Positionierungen hinterfragen und zugunsten einer einfühlsamen Haltung den Klienten gegenüber fallen lassen.)
Nun haben wir aber heute die Möglichkeit der gezielten „Familienplanung“ – gegebenenfalls mit fachärztlicher Hilfe (und damit auch einen lukrativen „Kinderproduktions-Markt“) – und damit stellt sich für alle, die bewusst „Kinder machen“ wollen die Frage ihrer Motivation. Die Wiener Autorin Brigitte Piwonka hat dies bereits 1995 in ihrem Buch „Der Kinderwunsch – ein Egotrip“ thematisiert. Es stellt eine Herausforderung an sich selbst dar, sich die eigenen Fortpflanzungsphantasien bewusst zu machen – vom unerfüllten Jugendtraum, von der Beseitigung eines unausgelasteten Alltags, vom Vererben des selbst Geschaffene an „eigen Fleisch und Blut“ bis zum Fortleben der eigenen Gene über den eigenen Tod hinaus …
Das Kind solle durch den Tod der Eltern nicht traumatisiert werden, war auch in den Zeitungen zu lesen. Ja, diese Gefahr besteht – für uns alle, egal wie alt wir sind, wenn wir geliebte Menschen verlieren. Aber wenn man verlässlichen Beistand hat, entsteht eher kein posttraumatisches Belastungssyndrom (PTSD), sondern „normale“ Trauer. Jahrelanger Gerichtskampf hingegen kann sehr wohl traumatisieren – dann nämlich, wenn die Selbstachtung einer Person permanent attackiert wird. Psychologische Kriegsführung nennt man das.
Bei aller berechtigter Kritik an sehr später Elternschaft ist festzuhalten: Es gibt mehr Problemlösungsmöglichkeiten als den Ersatz des einen – leiblichen – Elternpaares durch ein anderes – und damit die Aufhebung der unseligen Konkurrenz, die schon in der Bibel vor König Salomo gebracht worden war (nachlesbar in 1 Könige 3,15–28). Eine dieser Optionen heißt Prävention: Vorsorge für den worst case (den schlimmsten Fall) und verantwortungsvolle Eltern disponieren üblicherweise in Familie und Freundschaft – mögliche spätere Adoptiveltern mit eingeschlossen! Hier könnte und sollte Beratung und Unterstützung (Mediation!) ansetzen: Nicht entweder – oder, sondern sowohl – als auch.