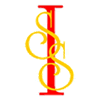Als ich noch Gerichtssachverständige war, wurde ich einmal gebeten, das Gutachten eines prominenten Kinderpsychiaters zu bewerten, der in Beantwortung der Frage, ob einem Vater, dem sexuelle Übergriffe auf seinen sechsjährigen Adoptivsohn vorgeworfen wurden, Besuchsrechte eingeräumt werden sollten, in etwa geschrieben hatte: Dies wäre unbedingt zu befürworten, denn dieser sei ja Diplomat, beherrsche mehrere Sprachen und könne das Kind daher besonders fördern. Die Mutter sei zwar auch Akademikerin aber doch schon einige Jahre nicht mehr im Beruf und daher könne man von ihr solch eine Förderung nicht erwarten.
Daran musste ich denken, als ich las, dass bei dem Freispruch des steirischen Arztes, dem seine nunmehr erwachsenen Kinder jahrelanges Quälen und Misshandeln vorgeworfen hatten, Aussehen und Kleidung der weiblichen Familienmitglieder als Indiz für deren mangelnde Glaubwürdigkeit als Geschädigte zitiert wurde (http://steiermark.orf.at/news/stories/2879536/ ). Nun finde ich es einerseits anerkennenswert und auch richtig, dass Richter ihre Überlegungen offenlegen – sie eröffnen damit ja auch Möglichkeiten, ihren Sichtweisen zu widersprechen, und das sehe ich als hohen Wert in der Demokratie.
Andererseits zeigt dies aber auch, wo es in der Ausbildung von Juristen an grundsätzlichem psychologischen Wissen mangelt: In unserem „Outfit“ verbergen sich bewusste wie auch unbewusste Selbstaussagen – etwa die, zu welcher Sozialschicht wir dazugehören wollen oder wer uns so imponiert, dass wir ihn oder sie nachahmen. Oder wo Klassengegensätze überspielt werden sollen: Der Sozialarbeiter in Latzhosen oder der Rockerpriester in der Lederjacke sind Beispiele dafür ebenso wie das Tragen von Einheitskleidung – Uniformen, Talare, Ornate, Hermeline – bei Angehörigen von Autoritätsberufen; es soll damit die verräterische individuelle Gestaltungsmöglichkeit eingeschränkt werden (was aber nicht gelingt, wenn ein Kriminalbeamter beispielsweise nach Dienstschluss in Flatterbermudas auf Rollerblades der Kaserne entstürmt …).
In der zitierten Urteilsbegründung heißt es: „Offensichtlich legt sie auf Kleidung, dem Anlass entsprechend, keinen Wert. Sie ist, was den Körperschmuck betrifft, in keiner Weise als konservativ zu bezeichnen.“ Diese Formulierung ist vermutlich eine korrekte Objektivierung – fraglich ist nur, welchen Sinn das in Bezug auf die strafrechtliche Beurteilung des Verhaltens des angeklagten Vaters haben soll.
Diese Antwort gebe ich jetzt so: Es ist ein deutlicher Hinweis auf sublime Selbstbeschädigungen, wie sie vielfach bei traumatisierten Personen zu beobachten sind. Wer unter seelischer Hochanspannung steht, fügt sich selbst Ritzungen, Schnitte, Verbrennungen oder sogar Löcher (z. B. in den Ohrläppchen) zu und „verkehrt“, d. h. verteidigt diese „Zeichen auf der Haut“ dann ins „Gegenteil“, z. B. als schön, modisch, … Sie können aber auch als unbewusster Protest gegen eine als grausam empfundene Gesellschaft gelten. Henne oder Ei? Was war zuerst? Solche Markierungen haben „Auszeichnungs“-Charakter – im Doppelsinn des Wortes: Es gibt Königstätowierungen wie Sträflingstätowierungen (oder Brandzeichen, eingesetzte Edel- oder sonstige Steine etc.), auf jeden Fall aber sind sie Botschaften, die in ihrer verborgenen Dramatik ernst genommen werden sollten.
In meiner Vorlesung „Angewandte Sozialpsychologie“ am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien versuche ich dieses Fachwissen künftigen JuristInnen nahe zu bringen: Soziale Auffälligkeit ist fast immer die Folge von – noch – unerkannten Traumatisierungen.