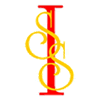Scham ist eine zentripetale Reaktion – man zieht sich quasi zusammen und in sein Inneres zurück (oder würde, wenn es ginge, gerne in den Boden versinken). Die – ebenso extreme, nämlich das Mittelmaß verfehlende – Gegenreaktion ist die Empörung: Man macht sich Luft, breitet sich aus und empor … und verliert oft den Boden unter den Füßen.
Oft folgt eines aufs andere – aber wenn das rechte Maß nicht verfehlt wird, denkt man darüber nach, weshalb man sich schämt, findet viele zusammenwirkende Auslöser, protestiert gegen die, bei denen Änderungen erreichbar scheinen (die vernünftige Art, sich Luft zu machen, anstatt bloß zu randalieren!) und arbeitet mit Disziplin und Geduld an Problemlösungen, wie schwer diese auch sein mögen. Klassisches Beispiel: chronische Krankheiten.
Viele schämen sich nicht nur ihrer eigenen Krankheiten – besonders, wenn sie das Äußere verändern – sondern auch ihrer Angehörigen. Scham ist dann eine innerpsychische Flucht ins Nirgendwo – und meist ausgelöst durch fremden Spott und / oder eigene Angst vor ernsthaft argumentierter übler Nachrede. Aktuell erlebt am Beispiel des ORF als Arbeitgeber. (Vormaliges Gegenbeispiel: ORF-Korrespondent Lorenz Gallmetzer hatte den Mut, ein Buch über seine Alkoholkrankheit zu schreiben. Hoffentlich hält er für die Zukunft durch! Es ist ihm zu wünschen.)
Im allgemeinen Sprachschatz wird mit dem Wort „Sucht“ – abgeleitet von „Seuche“ und „siech“, nicht von „Suche“! – verschleiert, dass es sich bei der Alkoholabhängigkeit um eine durchaus vergleichbare Analogie zur Insulinergänzungsabhängigkeit von Diabetiker:innen handelt, wie die deutsche Suchtexpertin Ursula Lambrou (* 1943) in ihrem Buch „Helfen oder aufgeben? Ein Ratgeber für Angehörige von Alkoholikern“ (rororo sachbuch 9955) erklärt: „Bei allen drei Krankheitsbildern lösen Mangel oder Übermaß einer Substanz im körpereigenen Stoffwechsel schwere Symptome aus, die die Gesundheit gefährden. Ein Diabetiker muss seinen Insulinspiegel kontrollieren, ein Allergiker die auslösende Substanz vermeiden, dann können beide fast normal weiterleben.“ Bei Alkoholikern funktioniere dies jedoch nicht: „Kein abhängig Trinkender kann seinen Alkoholgebrauch auf Dauer kontrollieren oder das Trinken einfach sein lassen …“ (S. 18, Hervorhebung von mir), denn, beschreibt die Fachfrau, nachdem sie etliche Erklärungen auflistet, „Bei manchen Menschen baut sich Alkohol langsam ab. In ihrem Körper kommt es plötzlich zu einer stark erhöhten Konzentration von Acetaldehyd, die mit einer leichten Vergiftung gleichzusetzen ist und zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Benommenheit führt. Solche Menschen werden selten zu Alkoholikern, da die unangenehmen Nachwirkungen sofort und heftig einsetzen.“ Bei den anderen bleibt Acetaldehyd nach einer Anpassungsphase von etwa vier Wochen längere Zeit im Körper und begünstigt die Bildung von körpereigenen Opiatvorläufern. Nun reagiert der Körper auf Acetaldehyd aber mit erhöhtem Flüssigkeitsbedarf – doch durch den erhöhten Acetaldehyd-Spiegel reicht Wasser nicht, sondern es muss dessen Absinken zwanghaft vermieden werden … und so entsteht eine fortschreitende Abhängigkeit von immer größeren Mengen bei gleichzeitigem Eindruck, dass der / die Abhängige „viel verträgt“ (S. 22 f.).
Lambrou mahnt Verständnis ein, denn nach einiger Zeit trete Angst auf, nicht nur die, das Leben ohne Alkohol „aushalten“ zu müssen, sondern vor allem Furcht „vor der eigenen unerklärlichen Schwäche, die sie überfiel, wenn es um Alkohol ging“ (S. 24). Schimpfen, Separieren, Spotten, Strafen hilft überhaupt nicht, sondern nur die Aufarbeitung der gesamten Biographie mit sämtlichen Auslösern bei gleichzeitigem körperlichem Entzug – und der ist lebensgefährlich, muss daher ärztlich begleitet werden.
Und weil Alkohol die Wahr-Nehmung behindert, sollten Angehörige – egal ob privat oder im Beruf – genau diese mit größtmöglicher Wertschätzung der Kranken in Ruhe aufrecht erhalten, nichts verharmlosen und nichts dramatisieren – und die eigene Scham-Biographie hinterfragen, denn: Die Wahrheit wird euch frei machen (Joh 8, 3).