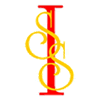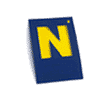Da schreibt Michael Simoner am 28. 09. im Standard in seinem Kommentar zu den „menschenunwürdigen Zuständen in einer Einrichtung für pflegebedürftige Menschen“, die Politik müsse „geeignete Rahmenbedingungen“ schaffen: „Mehr Personal, bessere Entlohnung und eine staatliche finanzierte Pflegsicherung, die keinen Unterschied zwischen armen und reichen Patienten mach“ (S.32).
Bei allem Verständnis und Mitgefühl für den Zeitdruck, unter dem Journalisten ihre Texte verfassen müssen (ich bin ja die Witwe eines solchen und habe miterlebt, wie mein Ehemann seinen Magen, sein Herz und zuletzt sein Hirn in diesem Beruf ruiniert hat), sind diese Verbesserungsvorschläge bloß quantitative.
Das Problem der Gewalt in der Pflege ist aber ein qualitatives – es betrifft die hohe Sozialkompetenz, die Personen benötigen, um mit schwierigen Personen in schwierigen Situationen gewaltverzichtend umgehen zu können. Diese erwirbt man aber nur in einer adäquaten Ausbildung und permanenter Intervision (d. i. Reflexion der Arbeit ohne externen „Besserwisser“). Tatsächlich wird aber gerade da gespart!
Sich ohne Aggression zu behaupten, bedarf großen pädagogischen Geschicks. Anleitungen dazu fehlen in den Ausbildungen – und gerade in Pflegeheimen sind gut ausgebildete Personen eher selten, weil gerade hier gespart wird. Man ist froh, überhaupt jemand für diese schwierige Aufgabe zu bekommen und schaut daher oft nicht so genau (und wiederholt!) auf die psychosozialen Kompetenzen der berufswerbenden Personen, wie es nötig wäre und bietet auch keine „Nachhilfe“ an. Würde man die Qualifikation der berufswerbenden Personen erhöhen – und dafür gibt es unterschiedlichste Modelle – befürchtet man Ansprüche auf höhere Entlohnung. Es demoralisiert aber, wenn man Menschen und ihren schöpferischen Anteil am Wohlergehen von uns allen nur mehr quantitativ pekuniär bewertet – ein Tabuthema, ich weiß, aber wollen wir zuwarten, bis die Spirale sich so weiter dreht, dass letztlich nur mehr Registrierkassen auf zwei Beinen herumlaufen und nur mehr Eurozeichen in den Augen glitzern haben? Während alle, die für einen höheren Sinn in ihrer Arbeit suchen als nur den Geld-„Schein“, als weder clever (weil „ausgebeutet“) noch smart (weil nichts zum „angeben“) definiert werden? Es gibt mehr Formen von Anerkennung als jene, die der „Markt“ anbietet (dazu habe ich etliche Konzepte in meinem Archiv). Es liegt an wagemutigen LandesrätInnen, hier neue Wege zu beschreiten – denn letztlich wurzeln all diese Gewaltformen im Streben nach „relativer Macht“ – d. h. Kompensation von Machtlosigkeit.
Heute wird von manchen Autoren „Machtkompetenz“ propagiert, erreicht aber damit nur die mit ihrer Machtlosigkeit Unzufriedenen. Der Schritt von der Macht zur Gewalt ist aber ein winziger. Das Gegenmodell ist der bewusst gewaltverzichtende Dialog (nach Buber und Bohm).
Gerne mehr Information dazu bei mir …