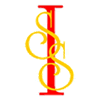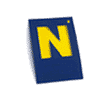Seitdem im Versuch, Beleidigungen zu vermeiden (was ziemlich sinnlos ist, denn wie man sich fühlt, entscheidet man selbst, vorausgesetzt man ist sich bewusst, über mehrere Alternativen zu verfügen – und das ist ein Erziehungseffekt!) die Wortschöpfung „verhaltenskreativ“ statt „nervt“ (oder ehrlich: „weiß nicht, wie damit umgehen“) Verwendung findet, wird Kreativität abgewertet. Außer bei erfolgreichen Künstlern oder Wissenschaftlern.
Das finde ich sehr schade – denn die Probleme der Zukunft werden wir nicht mit Pünktlichkeit und Gehorsam, sprich Angepasstheit an militärische Disziplin lösen. (Zur Erinnerung: Als unter Maria Theresia 1774 die allgemeine Unterrichtspflicht – nicht Schulpflicht! Häuslicher Unterricht ist möglich! – eingeführt wurde, waren die ersten Lehrer ehemalige Militärangehörige – und die haben exerziert.) In den Filmen über die Trapp-Familie befleißigt sich Baron Trapp auch solcher Methoden … Inzwischen weiß man, dass auf diese Weise nur derartige Umgangsweisen weiter gegeben werden, nicht aber Inhalte und deren Sinn und schon gar nicht soziale Kompetenzen (ethische mitgemeint).
Kreativität ist eigentlich etwas Angeborenes – das kann man auch bei Tieren beobachten, wenn sie Probleme zu lösen versuchen, und das tun sie, wenn sie etwas „wollen“. Da kann es schon mal Pannen geben – und die werden zwar gerne über soziale Medien breit verteilt, nur wenn das eigene Kind (oder Haustier) dabei etwas ruiniert, findet das kaum jemand süß oder lustig, sondern reagiert meist wütend. Als Folgen zeigen sich bei den so Gemaßregelten verstecken, weglaufen, abstreiten, lügen (das ist der letzte Rest von Kreativität!) und manchmal sogar nachhaltige Traumatisierungen. Irgendwann ist dann Neugier ebenso verschwunden wie die Lust am Erfinden; sie ist ängstlicher Vorsicht gewichen. Damit das nicht passiert, sollten kreative Schöpfungen anerkannt – und wenn nötig, in sozial verträgliche Formen gelenkt werden.
Genau dafür braucht es die „Musischen Fächer“ in den Schulen – und die Grundlagen dazu bereits im Kindergarten. Vor allem dann, wenn daheim weder gesungen oder musiziert, getanzt oder gesportelt, gezeichnet, gemalt, gebastelt, gebaut – und gelesen wird. Oder auch nicht interessiert und einfühlsam geredet.
Ich beobachte gerade im heurigen Jahr der Pandemie sehr genau, welche Menschen privat oder beruflich selbst, d. h. kreativ, nach innovativen Lösungen zum Einkommensgewinn wie auch zu verbesserter Zusammenarbeit suchen – und welche nur warten (und schimpfen), dass Vater Staat sie befürsorgen soll. Viele haben mich um Beratung ersucht (bin ja auch Projekt- und Unternehmensberaterin), und da habe ich immer wieder erfahren, dass viele schon einige gute Ideen hätten – aber die Kritik oder Spott fürchteten, und zwar genau von den Nahestehendsten: Eltern, Partnerpersonen, angeblichen Freunden …
So pflanzt sich der „Abwertungsfluch“ fort. Dabei müsste man die Energie, die man aufs Runtermachen verwendet nur fürs Aufbauen einsetzen – und für einen gelassenen Umgang mit Fehlern. Dafür braucht es Vorbilder, Übung und – Mutmacher! Der so unerwartet und tragisch verstorbene ehemalige Sozialminister Alfred Dallinger (https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dallinger) sagte immer: „Die Utopien von heute sind die Realität von morgen!“